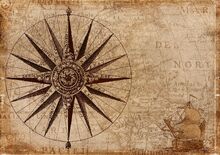
Fernweh ist eine Sucht. Eine Krankheit. Ein rücksichtsloses und im Grunde unheilbares Fieber, das es einem schier unmöglich macht, mit seinem Leben zufrieden zu sein. Die Erreger sind überall. Dokumentationen, die fremde Städte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten zeigen, und Filme und Serien, die sie mit faszinierenden Abenteuern füllen. Exotische Düfte und Klänge, die verlockende Bilder in unsere hilflosen Gehirne injizieren, wie unsichtbare, aber zutiefst aggressive Skorpione. Reiseberichte von anderen Erkrankten, die mit jedem ihrer wohlgesetzten Worte das Virus weiterverbreiten, und Reisebüros, die mit dem Leid der Infizierten gnadenlos Profite machen, indem sie ihnen unwiderstehliche Angebote für den nächsten Schuss, den nächsten Fieberschub, unterbreiten.
Ihr mögt meine Ansichten für übertrieben halten. Für das Gequatsche eines verbitterten Zynikers. Was ist schon verkehrt daran, neue Länder kennenzulernen, seinen Horizont zu erweitern und seine kleine, enge Alltagswelt von Zeit zu Zeit hinter sich zu lassen?
Nun, rein gar nichts. Genauso wenig, wie es verderblich ist, gelegentlich ein Glas Wein zu trinken oder sich eine Tafel Schokolade zu gönnen. Wie so oft, macht die Dosis das Gift.
In kleinen Dosen ist Fernweh unproblematisch und vielleicht sogar bereichernd für unser Leben. Aber es gibt Menschen, denen ein Gläschen nicht reicht. Die nicht erkennen können oder wollen, wo ihre Grenzen liegen.
Ich bin so ein Mensch, und ein kleiner Pauschalurlaub von Zeit zu Zeit stellt mich schon lange nicht mehr zufrieden.
Eigentlich stamme ich aus Deutschland. Genauer gesagt aus einer miefigen, ländlichen Gegend dieses Landes. Der Wunsch, mehr von der Welt zu sehen, begleitete mich schon seit meiner Kindheit. Leider haben meine Eltern weder das Geld noch die Zeit für großartige Urlaubsreisen gehabt. Und ich freute mich umso mehr über jede der seltenen Gelegenheiten, zu denen sie mit mir wenigstens in eine der größeren Städte fuhren, auch wenn das oft genug zu Problemen führte.
Denn nicht selten stahl ich mich bei der erstbesten Gelegenheit davon, um jede einzelne Gasse, jeden Hinterhof und jede Seitenstraße zu erforschen. Oft mussten meine Eltern mich stundenlang suchen und gelegentlich sogar die Polizei einschalten. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass mir das eine Menge Ärger eingebracht hat.
Alles in allem hasste ich meine Kindheit, und da mir die Möglichkeit von realen Reisen verwehrt blieb, nutzte ich jede Chance, wenigstens geistig auf Reisen zu gehen.
Ich konsumierte alles, was ich in Büchern, im Fernsehen oder im Internet über fremde Länder fand. Ich dachte auch öfter darüber nach, online Kontakte zu Menschen aus anderen Ländern zu knüpfen, sah aber letzten Endes davon ab. Es hätte das Mysterium zerstört. Wenn ich eins nicht wollte, dann war es zu erfahren, dass die Menschen in diesen Ländern letztlich auch nicht anders waren als ich. Ich wollte keine Völkerverständigung, keine Überwindung von Unterschieden.
Ich wollte das Fremde, das Unbegreifliche, das Seltsame. Ich wollte Orte besuchen, an denen ich mir wunderbar verloren vorkam. Deshalb sehnte ich mich mit der Zeit auch nicht mehr danach, internationale Großstädte zu besuchen, in denen es ohnehin überall die gleichen Clubs, Burger-Buden und Szene-Treffs gab. Ich suchte vielmehr nach lokalen Eigenarten, bizarren Bräuchen, kuriosen Überlieferungen und dergleichen und verlor mich mehr und mehr in derlei Fantasien und Tagträumen.
Wahrscheinlich wäre es unter normalen Umständen auch bei meinen Träumereien geblieben. Selbst unsere Klassenfahrten führten uns nicht über die Landesgrenzen hinaus, und auch wenn ich die Schule einigermaßen ordentlich abschloss (was vor allem an meiner Begeisterung für Geografie, Geschichte und Fremdsprachen lag), so kam ich bei meinen Plänen, einen Beruf zu ergreifen, der meinem Fernweh entgegenkam oder der mir zumindest genügend Geld für weite Reisen einbrachte, kaum voran. Bei allem, was nicht mit Sprachen oder fremden Ländern zu tun hatte, fehlten mir schlichtweg die Konzentration und die Motivation, um wirklich gut oder auch nur akzeptabel darin zu sein.
Aber das Schicksal eröffnete mir einen anderen Weg zur Befriedigung meiner Sucht.
Eines Tages, als ich wieder ziellos und frustriert durch die Straßen meines provinziellen Kuhkaffs streifte, in dem ich im Übrigen so gut wie keine Freunde hatte, da niemand meine Leidenschaft für fremde Länder in gleicher Weise teilte und ich kein Interesse daran hatte, meine Zeit mit Smalltalk über die üblichen Themen zu vergeuden, entdeckte ich an einer Bushaltestelle etwas sehr Interessantes.
Das heißt, auf den ersten Blick war es eigentlich gar nicht interessant. Vielmehr handelte es sich um den zerfledderten Prospekt eines Reisebüros. Normalerweise war ich zwar nicht der Typ, der Müll von der Straße aufhob, aber da ich sonst nichts zu tun hatte, hob ich den Prospekt auf und setzte mich damit auf einen der beiden leeren Sitze des Wartehäuschens. Der Prospekt war ziemlich dick und trug das Logo einer Reisegesellschaft, die mir vollkommen unbekannt war. Dies allein war schon bemerkenswert, da ich mich schon oft nächtelang durch die Angebote der verschiedensten Anbieter gewühlt hatte. Aber ein Reisebüro mit dem Namen „Endless Horizons“ war mir bislang noch nicht begegnet. Auch das Logo, welches zwei Wellen zeigte, deren Schwung zusammen die Zahl „69“ bildete, war mir vollkommen unbekannt.
Das Cover, das einen zerfallenen und von Ranken zugewucherten Maya-Tempel inmitten des Dschungels abbildete, übte aber – obwohl ziemlich zerknittert – die nötige Faszination auf mich aus, um mich zum Durchblättern dieses Fundstücks zu bewegen.
Ich schlug also eine der vorderen Seiten auf und blickte auf eine chinesische Marktszene. Der Markt war gut besucht. In den Auslagen befanden sich Obst-, Gemüse-, aber auch Fleischsorten, wie man sie hierzulande kaum findet, aber auch getrocknete Kräuter, verschiedene Wurzeln, lebende Tintenfische, Insekten und vielerlei weitere exotische Köstlichkeiten. Zwischen den Menschenmengen deuteten sich kleine, schmale Gassen an, und neugierig, wie ich war, fragte ich mich sofort, was sich dahinter befinden könnte. Meine von unerfüllter Sehnsucht geschulte Fantasie fütterte meinen Geist mit einer Flut von Bildern und möglichen Szenarien, und plötzlich meinte ich sogar, die würzigen, intensiven Düfte wahrnehmen zu können und die feuchte, warme, stickige Luft auf meiner Haut und in meinem Mund zu fühlen.
Genießerisch schloss ich für einen kurzen Moment die Augen, und als ich sie wieder öffnete, war ich dort.
Ich stand tatsächlich in einer dieser schmalen Gassen, in der sich die Eingänge zu den anliegenden Wohnhäusern befanden, und konnte vor mir die Hauptstraße mit den Marktständen sehen. Kein Zweifel: Ich war hier. Ich war wirklich und leibhaftig zum ersten Mal in meinem jämmerlichen Leben in einem fernen Land.
Ich, der kaum je aus diesem verschissenen Kaff herausgekommen war. Irgendwie hatte mich dieser alte, zerknitterte Reisekatalog hierher gebracht. Es war fast wie in einem dieser Märchen, von denen mir meine Mutter als Kind immer viel zu wenige vorgelesen hatte. Aber das war jetzt egal. Das hier war real. Das war alles, was zählte. Ich spürte Feuchtigkeit auf meiner Wange und realisierte, dass ich weinte. Freudentränen. So musste sich ein Gefangener fühlen, der nach zwanzig Jahren Haft zum ersten Mal wieder einen Schritt in Freiheit tat.
Plötzlich hörte ich eine aufgebrachte Stimme hinter mir. Als ich mich daraufhin umdrehte, sah ich dort eine alte, runzlige Frau. Zwar verstand ich nicht im Geringsten, was sie sagte, aber ihre Gesten gaben mir deutlich zu verstehen, dass ich aus dem Weg gehen sollte. Ich lächelte sie an und trat tatsächlich zur Seite. Sie ging ohne ein weiteres Wort an mir vorbei, wobei sie mir noch einen schrägen Blick zuwarf.
Das Gefühl, hier fremd zu sein, wurde vollkommen übermächtig. Niemand kannte mich hier. Niemand verstand meine Sprache oder meine Kultur und ich nicht die ihre, wenn man von ein paar Klischees und Vermutungen einmal absah. Ich hatte keine Ahnung, wo genau ich war und wie – oder ob – ich wieder nach Hause kommen würde. Ich hatte nicht mal mehr das Gefühl, überhaupt noch eine Heimat zu haben. Vielen Menschen würde dieser Gedanke Angst machen, aber in mir löste er eine ungeahnte Euphorie aus. Mein ganzes Leben über war ich regelrecht mit Heimat zugeschüttet worden. Hatte an ihrem Tropf gehangen und hatte ihre erstickende Geborgenheit wie einen Kloß in meinem Hals gefühlt. Hier aber war ich frei.
Dennoch wagte ich ein Experiment und versuchte mir für einen Moment wieder die dreckige Bushaltestelle vorzustellen, an der ich eben noch gestanden hatte. Ich schloss die Augen und versuchte das Bild meiner sogenannten Heimat in meinem Geist genauso lebendig werden zu lassen wie das des chinesischen Marktes, auf dem ich mich nun befand.
Es funktionierte sogar einigermaßen. Die Bilder meines Heimatdorfes wurden in meinem Kopf beinah real. Aber als ich die Augen wieder öffnete, war ich trotzdem immer noch in China.
Ein befreiendes Gefühl der Endgültigkeit breitete sich in mir aus. Ich würde nicht mehr zurückkönnen. Selbst auf konventionellem Wege wäre das nicht so einfach möglich, da ich nicht mehr als ein paar Euro in der Tasche und auch nicht viel mehr auf meinem Konto hatte. Ich hätte mich hier wahrscheinlich viele Monate lang mit irgendwelchen Hilfsjobs durchschlagen müssen, bis ich irgendwann genügend Geld für die Heimreise zusammengehabt hätte. Aber das wollte ich auch überhaupt nicht.
Es war nicht so, dass ich meine Eltern hasste oder sie mir egal waren. In Wahrheit war – da ich keine Freundin und auch keine wirklichen Freunde hatte – die Vorstellung, sie nie mehr zu sehen, das Einzige, was mich in diesem Moment etwas traurig stimmte. Aber das Gefühl des Fernwehs war stärker. Ich hielt den Reisekatalog nach wie vor in meinen Händen, und er versprach mir hunderte von exotischen Reisezielen. „Unendliche Horizonte“ – anscheinend war das ausnahmsweise mal ein Firmenname, der hielt, was er versprach.
Ich verspürte den starken Drang, mich sofort zu meinem nächsten Reiseziel zu begeben und zu sehen, welche Wunder der Katalog noch für mich bereithalten würde. Aber zunächst entschloss ich mich dazu, meinen aktuellen Aufenthaltsort etwas genauer zu erforschen.
Ich streifte also mehr oder weniger ziellos durch die verwinkelten Gassen, beobachtete die Menschen, wie sie ihrem Tagewerk nachgingen, und nahm tatsächlich auch einige Gelegenheitsjobs an, als mein Magen zu knurren begann, auch wenn das wegen der Sprachbarriere nicht so leicht war. Es war aber auch nicht unmöglich. Denn wenn es darum ging, Dinge zu schleppen oder Böden zu schrubben, sind Sprachkenntnisse zum Glück nicht von allzu zentraler Bedeutung.
Auf diese Weise lebte ich einige Wochen vor mich hin, erkundete die Stadt und das umliegende Land und schlief in der Nacht entweder bei einem meiner Arbeitgeber oder einfach auf offener Straße. Doch schließlich vernahm ich erneut den sirenenhaften, bittersüßen Ruf des Fernwehs. Ich hatte mich schon viel zu lange an diesem Ort aufgehalten und zugelassen, dass sich wieder etwas wie Gewohnheit, Vertrautheit, ja sogar beinah ein Gefühl von Heimat in mir breit machte. Es war höchste Zeit, zu neuen Horizonten aufzubrechen. Damals war ich noch der festen Überzeugung gewesen, dass dieser Wunsch aus mir selbst entsprang und nichts mit dem mysteriösen Reisekatalog zu tun hatte. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Jedenfalls warf ich einen letzten Blick auf die engen, stickigen Gassen der Stadt, nahm den Katalog zur Hand, den ich sicher in dem Rucksack verstaut hatte, welchen ich glücklicherweise fast immer mit mir führte, blätterte ein wenig durch die Seiten und entschied mich für mein nächstes Ziel.
Nach und nach bereiste ich auf diese Weise die ganze Welt. Ich reiste buchstäblich in alle Metropolen der Erde, besuchte unentdeckte Kannibalenstämme in dichten Dschungeln, bereiste isolierte Inselgruppen und verbotene, heilige Orte mannigfaltiger Religionen. Ich erforschte das australische Outback und die skandinavischen Wälder und sah sogar Orte, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte, die sich aber dennoch unter dem gleichen blauen Himmel befanden, unter dem ich einst geboren worden war. Ich entdeckte viele Wunder und viel Schönheit, sowohl in den Menschen als auch in der Natur, aber heute muss ich mir eingestehen, dass es eher die menschlichen Abgründe waren, die mich anzogen. Das Düstere. Das Okkulte. Das Morbide.
Ich sah von Inzest geprägte Dörfer voller degenerierter Einwohner. Ich beobachtete Menschenopfer, rituelle Verstümmelungen, Folter, Vergewaltigungen, Menschenhandel. Ich sah Kinder, die einfach in der Wildnis ausgesetzt oder in Flüsse geworfen worden, weil sie Behinderungen aufwiesen oder aus irgendeinem Grund als unrein oder verhext galten, und dergleichen mehr. All diese Eindrücke sog ich in einer Art von abartigem, voyeuristischem Vergnügen in mich auf und berauschte mich daran und an meiner eigenen Unangreifbarkeit. Denn immer, wenn man mich entdeckte und mich für meinen Frevel bestrafen oder mich als Zeugen beseitigen wollte, flüchtete ich an den nächsten aufregenden Ort.
Der Katalog schien mir eine nie endende Auswahl an Reisezielen zu bieten. Und dennoch war dieser Eindruck trügerisch. Denn die Seitenzahl war zwar hoch, aber endlich. Und noch dazu war mir ein Teil des Katalogs nicht zugänglich. Ganz am Ende waren einige Seiten durch ein schwarzes Deckblatt abgetrennt, auf dem in dicken weißen Buchstaben stand:
Für Fortgeschrittene
Die Seiten dahinter ließen sich nicht einsehen. Es war fast so, als würden sie von irgendeiner Kraft zusammengehalten, auch wenn ich keinen Kleber oder etwas Ähnliches erkennen konnte. Ich dachte kurz darüber nach, sie gewaltsam auseinanderzuziehen, entschied mich aber am Ende dagegen. Immerhin wollte ich den Katalog nicht beschädigen. Wer sagte mir, dass er dann noch funktionieren würde? Also übte ich mich – trotz aller Neugier darauf, was sich hinter dieser mysteriösen Seite verbergen mochte – in Geduld.
Lange musste ich aber nicht warten. Denn schon bald hatte ich einen Großteil der zugänglichen Orte besucht, und ich stellte außerdem bei entsprechenden Versuchen fest, dass ich jeden Ort nur einmal besuchen konnte. Nicht nur, dass meine Bestrebungen, ihn zu visualisieren, zu nichts führten, die jeweiligen Seiten verblassten sogar mit der Zeit, bis sie irgendwann vollkommen weiß und leer waren. Ein Zurück gab es also nicht mehr, und jede Reise blieb somit eine einmalige Erfahrung.
Gleichzeitig bemerkte ich, dass die Zeitspanne, über die mich die Wunder eines bislang unbekannten Ortes fesselten und faszinierten, immer kürzer wurde. Zunächst dauerte es immer ein oder zwei Wochen, später meist nur noch wenige Stunden, bis ich den Ruf der Ferne erneut in solcher Klarheit und Dringlichkeit vernahm, dass ich ihm einfach folgen musste. Ohnehin war mein ganzes Wesen von immer größerer Unruhe geprägt, und mich beschlich das unangenehme Gefühl, dass mich wohl nichts auf dieser Welt noch wirklich würde faszinieren können. In Wahrheit verschmolzen all die unbekannten Städte, Dörfer und Landschaften zuletzt zu einem undifferenzierten, traumhaften Strom aus Bildern, der an meinen Augen und meinem Geist vorbeirauschte, ohne dabei irgendwelche bleibenden Spuren zu hinterlassen.
Schließlich kam der Tag, an dem ich mein letztes „normales“ Reiseziel besucht hatte. Als ich das realisierte, befand ich mich gerade am Strand einer offensichtlich unbewohnten Insel, die aber gleichwohl bevölkert wurde von Waranen, bemerkenswert großen Spinnen und Ameisen sowie von diversen Schlangenarten. Ich hatte die Insel akribisch nach Zeichen von menschlichem Leben abgesucht, in der Hoffnung, auf irgendeinen mysteriösen, bislang von den Fesseln der Zivilisation verschonten Stamm mit unbekannten Bräuchen und Eigenheiten zu treffen, aber dabei absolut nichts entdeckt.
Entsprechend enttäuscht und desillusioniert saß ich im Sand und nahm einmal mehr den Katalog zur Hand. Hinter mir der gefährliche und doch so uninteressant gewordene kleine Wald, um mich herum ein Ozean, dessen titanische Weite und Tiefe mir mit einem Mal so erstickend eng und gewöhnlich vorkamen, und über mir der blaue Himmel, der auf mich kaum mehr Faszination ausübte als ein nachlässig gemaltes Deckenbild für Kinder. In Wahrheit – das weiß ich jetzt – hatte mich in diesem Moment rein gar nichts mehr fasziniert. Ich war nichts weiter als ein Junkie auf der Suche nach dem nächsten Schuss, und ich musste dringend die Dosis erhöhen. Hastig blätterte ich durch die leer gewordenen Seiten zu dem schwarzen Abschnitt und hoffte, nein BETETE, dass er sich für mich öffnen würde.
Er tat es.
Ich konnte das Deckblatt („Für Fortgeschrittene“) so einfach umblättern, als wäre das die ganze Zeit über schon möglich gewesen. Auch die Seiten dahinter waren schwarz. Und statt irgendwelcher Szenen oder Landschaftsaufnahmen waren darauf lediglich Worte abgedruckt. Worte, die ich nicht verstand, die aber eine seltsame, fremdartige Anziehungskraft auf mich ausübten. Das erste davon lautete:
Andradonn
Da ich diesmal kein Bild hatte, in das ich versinken konnte, spürte ich dem Klang dieses Wortes nach. Er klang schwer, erdig. Wie der Schlag eines Hammers gegen eine Glocke. Ich versuchte eins mit diesem Klang zu werden, mit jedem einzelnen Buchstaben des Wortes. Und tatsächlich: Es gelang.
Der Strand war verschwunden. Stattdessen fand ich mich in einer Stadt wieder, die sich auf den ersten Blick kaum von westlichen Metropolen wie Berlin, New York, London oder Paris unterschied.
Es gab dort Geschäfte, Hochhäuser, Passanten, Autos und alles, was man in einer Großstadt erwartete. Auch die Menschen selber sahen ziemlich gewöhnlich aus. Zunächst war ich etwas enttäuscht – irgendwie hatte ich etwas … Geheimnisvolleres … erwartet – aber auf den zweiten Blick zeigten sich die Unterschiede.
Die Menschen in Andradonn bewegten sich seltsam ruckartig, schwankend und irgendwie schleifend, so als hätte sich irgendwo in ihrem Genpool eine Raupe oder ein Wurm verewigt.
Die Geschäfte boten auffallend viele Waffen an – von Messern und Armbrüsten bis hin zu vielerlei modernen Schusswaffen. Es gab aber auch Geschäfte, die offen für Folterwerkzeuge warben und deren Plakate deren Anwendung explizit und äußerst grafisch darstellten. Manche davon wurden sogar als Sonderangebote angepriesen. Und es gab Lebensmittelläden, die Dinge anboten, die ich zwar nicht genau identifizieren konnte, die aber streng rochen und in mir vage Assoziationen zu Organen und Gedärmen hervorriefen.
Die Menschen, die ihre Autos verließen, stiegen nicht einfach nur aus ihnen aus. Sie lösten sich vielmehr mit einem lauten Schmatzen aus ihren Sitzen, und wenn sie sich von ihren Fahrzeugen wegbewegten, spannten sich dabei organisch wirkende Fäden zwischen den Autos und ihren Körpern, wie bei geschmolzenem Käse auf einer Pizza. Erst wenn die Fahrgäste, die allesamt gleichgültige und leere Gesichter besaßen, ungefähr zehn Meter von ihrem Gefährt entfernt waren, zogen sich die Fäden wieder in das Fahrzeug zurück. Danach fuhren die Autos selbstständig weiter und suchten sich neue Fahrgäste, wobei sie die meisten von ihnen offensichtlich gegen ihren Willen „einsammelten“. Eine Frau, die auf der anderen Straßenseite entlanglief, wurde von vier umherpeitschenden Tentakeln gepackt, die aus einem rot lackierten Kleinwagen schossen und sie dann einfach über den Asphalt schleiften, als wäre sie ein Fisch an einer Angel. Die Frau schrie mit einer grotesk tiefen, raubtierhaften Stimme, deren Klang ich jetzt noch in den Ohren habe. Erst jetzt bemerkte ich auch, dass manche der Passanten sich ängstlich in die Eingänge von Geschäften, hinter Mülltonnen oder Werbeplakate duckten, um nicht von einem der Fahrzeuge erwischt zu werden. Ich kannte diese Welt nicht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht unbedingt eine gute Idee war, sich von einem dieser Fahrzeuge einfangen zu lassen.
Ich ließ meinen Blick umherschweifen und entdeckte am Ende der Straße ein pulsierendes, gänzlich schwarzes Gebäude, das an ein mittelalterliches Schloss erinnerte und das zwei breite, burgtorartige Eingänge besaß. Das Bauwerk hockte zwischen den strahlend weißen, modernen Häuserfronten wie eine fette, hungrige Spinne und präsentierte auf einer Art Anzeigetafel in riesenhafter, goldener Neonschrift kryptische Schriftzeichen, die alle paar Sekunden wechselten. Dass es sich dabei um verschiedene Sprachen handelte, die wahrscheinlich aus allen denkbaren Ländern und Dimensionen stammten, begriff ich erst, als schließlich auch meine eigene darauf zu lesen war. Die Aufschrift besagte demnach folgendes: „Ministerium für Wesensentkernung“
Die Worte erzeugten ein beklemmendes Gefühl in meiner Brust, was nicht zuletzt daran lag, dass sie meine Fantasie stärker anregten, als es mir lieb sein konnte. Erst jetzt fiel mir auf, dass die meisten der menschensammelnden Autos direkt in den linken Eingang des Ministeriums hineinfuhren und einige andere es durch das rechte Tor wieder verließen.
Zum ersten Mal während all meiner Reisen stieg echte Angst in mir hoch, die noch dadurch verstärkt wurde, dass nun ein großer, schwarzer Kombi im Begriff war, direkt neben mir vorbeizufahren, wobei ich den Eindruck hatte, dass seine Scheinwerfer mich wie zwei wachsame Augen fixierten.
Ich reagierte sofort und doch hatte ich gerade einmal geschafft, den Reisekatalog aus meinem Rucksack zu holen, als der Wagen bereits diese dünnen, gierigen Fäden aus seiner Karosserie hervorstreckte. Kalter Schweiß brach aus all meinen Poren heraus, meine Hände zitterten und mein Überlebensinstinkt riet mir, einfach nur wegzulaufen. Aber ich kämpfte diesen Impuls nieder. Das Ding würde mich einholen. Meine einzige Chance auf Flucht lag in dem Katalog. Hastig schlug ich ihn auf der nächsten Seite auf:
Itsch Zingtzschar
stand darauf. Ein Wort, wie aus einem Schlangenmund. Ich schloss die Augen und blendete den Gedanken an das organische Auto, an den „Sammler“, aus. Verdrängte mit aller Kraft die Vorstellung, dass die Fäden jeden Moment meinen Nacken berühren und mich in sein Inneres und dann in dieses schreckliche Gebäude zerren könnten. Es gab nur noch das Wort. Ich wurde das Wort.
Als ich die Augen öffnete, war der Himmel nicht mehr blau – er war violett. Die Sonne hingegen, die dreimal so groß wie gewohnt am Himmel stand, war blau. Ein lodernder, hellblauer Ball wie aus chemischem Feuer, der die schroffe, steinige Landschaft, die sich vor mir ausbreitete, in ein gespenstisches, unwirkliches Licht tauchte. Die Luft war warm, aber staubtrocken, und ich konnte kleine Staubpartikel sehen, die wie winzige Diamanten schimmerten. Ein Geruch wie von heißem, nassem Asphalt erfüllte meine Nase.
Das Geräusch von Wellen drang an meine Ohren und lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein aufgewühltes, schwarz glänzendes, peitschendes Meer. Als ich meine Augen darauf richtete, erkannte ich, dass ich auf einer hohen, felsigen Klippe stand, die sich sicher dreißig Meter über den Meeresspiegel erhob.
Die Welle war höher.
Und die Flüssigkeit, aus der sie bestand, war ganz sicher kein Wasser. Sie war vielmehr pechschwarz und ölig und trug einen scharfen, vergorenen Geruch mit sich, der meine Nase reizte und meine Augen brennen und tränen ließ. Es war, als hätte man Hausmüll verflüssigt und ihn mit scharfen Chemikalien gemischt. Ich wollte – nein, durfte – von dieser Welle nicht berührt werden. Und doch erkannte ich, dass sie mich einholen würde.
Diesmal rannte ich tatsächlich. Ich rannte, wie ich noch nie zuvor gerannt war, und wären meine Beine nicht bereits von all den vielen Reisen gut trainiert gewesen, so hätte ich nicht die geringste Chance gehabt, der Brühe zu entgehen.
Doch auch so schaffte ich es nicht.
Zwar gelang es mir, der eigentlichen Welle zu entkommen und mich zuletzt mit einem hastigen Sprung aus der Gefahrenzone zu befördern, aber einige Spritzer erreichten dennoch meine Klamotten. Das Zeug fraß sich sofort gierig durch sie hindurch, aber es war nicht wie bei Säuren oder anderen Chemikalien. Es war mehr, als… als würde die Flüssigkeit leben. Als wäre sie hungrig auf den Stoff meiner Kleidung, und viel mehr noch auf das, was unter meiner Kleidung lag. Hastig und gerade noch rechtzeitig streifte ich meine Hosen und mein T-Shirt vom Körper und ließ sie einfach liegen, während sich diese Flüssigkeit erst über die Kleidungsstücke hermachte, dann aber langsam auf ich zuzukriechen begann. Nur mit Unterwäsche und Rucksack bekleidet (den ich glücklicherweise bei meiner Flucht vor der Welle nicht verloren hatte), kämpfte ich mich in eine aufrechte Position und rannte einfach weiter.
Nach einiger Zeit schien das Nicht-Wasser seine Verfolgung aufzugeben.
Ich sah mich um und erblickte eine Art… Stadt. Eigentlich passte dieser Begriff nicht, aber es war der Beste, den ich hatte, um das zu beschreiben, was ich vor mir sah. Die Gebäude hier waren nicht mehr als schiefe, völlig unlogisch konstruierte, ruinenartige Gebilde, die im bläulichen Licht der Sonne groteske Schatten warfen. Und es waren Hunderte von ihnen. Tausende. Vielleicht noch viel mehr, die sich allesamt an eine dünne, lange, gepflasterte Straße aus grünlichen, glitschigen Ziegeln drängten wie verlorene, ängstliche Kinder an den Leib ihrer toten Mutter. „Tod“ war das passende Stichwort. Genau das atmete diese Stadt mit jedem ihrer unsichtbaren Atemzüge aus. Die niederschmetternde und endgültige Essenz des Todes. Eine Mischung aus Traurigkeit und grenzenloser Furcht, die jeden Lebensmut zu packen und mit scharfen Klingen zu zerlegen drohte.
Doch das war noch nicht alles. In der Ferne, ganz am Ende des sichtbaren Bereichs der Straße, sah ich SIE. Gebeugte, kriechende, humanoide Gestalten. Ich konnte sie nicht genau erkennen, sah in dem fremden Licht und unter den blassen Nebelbänken, die an einigen Stellen über diese Stadt der Toten hinwegzogen, kaum mehr als Schatten. Aber dennoch sah – oder empfing – ich einzelne Bilder von ihnen. Ich sah ihre trostlosen, verlorenen Rudel. Sah ihre langen, staksigen Glieder, ihre schiefen, mit zu vielen Zähnen gefüllten Münder. Ich sah Augen, die den oberen Teil ihrer Köpfe fast gänzlich ausfüllten und die stets in unterschiedliche Richtungen blickten. Ich sah, dass sie an irgendetwas nagten. Und ich spürte, dass sie sich sehnten. Nach Wärme, nach Leben, nach Fleisch und nach etwas, dass ich noch viel weniger hergeben wollte – hergeben konnte – als diese Dinge. Schlimmer als all diese Erkenntnisse war aber eine andere:
Sie hatten mich entdeckt. Das wusste ich ohne jeden Zweifel. Und sie kamen näher. Sehr langsam zuerst, als wären sie torkelnde Betrunkene, die sich desorientiert auf ihren Heimweg machten, doch beängstigend schnell, als ich den Katalog herausholte. Kurz bevor ich das nächste Wort las und aus dieser Hölle floh, konnte ich noch einen Moment lang ihre Stimmen hören. Sie riefen meinen Namen.
So ging es weiter. Ich besuchte die ratternden, endlosen Maschinengärten von „Dank Qua“, die nebligen Grabfelder von „Luth Nomor“, die Nadelwelten von „Rihn“, die blutsaufenden Pilzgärten von „Qui Wahtsche“, die zitternden Labyrinthe von „Jin Dragag“, die von nie endenden Schlachten gepeinigten Ebenen von „Konor“, die heulenden, lichtlosen Wälder von „Urg“, die schwitzenden Seuchenhöhlen von „Hyronanin“ und viele weitere, zumeist schreckliche Orte voller albtraumhafter Geschöpfe, gestaltloser Ängste, feindlicher Naturgewalten und verdrehter Naturgesetze.
Nun liege ich in IHREM Bett, wenn man es so nennen kann. „Xakraschidaa“ war das Wort gewesen, IHREM Namen aber kenne ich nicht, falls SIE überhaupt einen hat. Viele von ihnen fressen ihre Männer nach der Paarung, aber SIE scheint nicht dazuzugehören. Auf irgendeine verdrehte Art scheint SIE mich zu mögen, auch wenn das schwer festzustellen ist. SIE ist nun mal mehr Insekt als Mensch und IHRE Facettenaugen sind stets ausdruckslos. IHRE Lippen hingegen sind wie meine, wie auch die Haut in IHREM Gesicht, auch wenn SIE Fühler statt Ohren besitzt. Manchmal küsst SIE mich, was mich ziemlich anekelt, da ich dann manchmal die Beißzangen in IHRER Mundhöhle mit meiner Zunge berühre. Oft wird mir sogar übel und ich spüre einen säuerlichen Geschmack in meiner Kehle. Aber bisher konnte ich mich beherrschen. Wer weiß, was SIE mit mir macht, wenn SIE merkt, dass SIE mir nicht gefällt.
Ohnehin sind die Paarungsakte schlimmer. Zunächst hätte ich nicht erwartet, dass es überhaupt möglich ist – wie sollte sich ein Mensch mit so einem Wesen paaren können? Aber es funktioniert.
Sogar… der Akt. Ich meine, anfangs dachte ich nicht, dass es… dass ich… meinen Mann stehen könnte, vor lauter Angst oder Ekel und dem Gefühl von harten, kaltem Chitin auf meiner Haut, oder diesem verstören Zirpen, Klicken und Quietschen, welches fast unablässig aus ihrem Mund dringt. Aber vielleicht sind es irgendwelche Duftstoffe, die an meiner Abscheu vorbei direkt auf die relevanten Teile meines Körpers wirken. Oder aber in mir verbirgt sich eine extreme Form von Xenophilie. Eine dunkle Perversion, derer ich mir selbst nicht bewusst bin. Ich weiß es nicht genau, auch wenn ich die erste Theorie für wahrscheinlicher halte, da ich nicht sonderlich viel Freude bei unseren Paarungsakten verspüre. Jedenfalls haben wir Kinder gezeugt. Viele von ihnen. Hunderte. Manche ähneln mir, haben fast menschliche Köpfe, manchmal sogar normale Augen zwischen ihren Fühlern. Andere hingegen…
Jedenfalls sprechen sie nicht. Und sie zeigen auch kein Interesse an mir. Dafür bin ich dankbar. So wie ich auch dafür dankbar bin, dass SIE und ihr Staat mich vor den Wesen beschützen, die vor ihrem Nest lauern. Unaussprechliche Geschöpfe, die unter den brodelnden Himmeln ihre langen, drohenden Schatten ausbreiten. Titanische Prädatoren, die selbst Götter das Fürchten lehren könnten. So bizarr, so bösartig und verstörend, dass SIE mir dagegen wie ein Geschenk des Himmels erscheint.
Dennoch kann ich nicht behaupten, dass ich glücklich bin. Ganz und gar nicht. Manchmal in der Nacht, wenn SIE mich in ihren Klauen hält, als wären wir ein ganz normales Paar, wenn ich vor Ekel und Angst nicht schlafen kann, denke ich an mein Zuhause. An mein miefiges, kleines Dorf. An meine Eltern. Und an den Katalog, den ich unter meinem Bett versteckt halte. An manchen Tagen lässt SIE mich allein, um zu jagen. SIE bringt mir dann immer fleischige, weiße Käfer mit langen Beinen und mächtigen Mandibeln mit. Sie schmecken abscheulich und sind oft noch halb lebendig, sodass ich sie zitternd und krabbelnd hinunterschlucken muss. Immerhin halten sie mich bei Kräften.
Noch wichtiger aber ist, dass ich an einem dieser Tage fliehen könnte. Ich könnte den Katalog hervorkramen und meine letzte Chance nutzen. Es gibt nur noch eine beschriebene Seite darin. Alle anderen sind leer. Das Wort auf dieser Seite habe ich noch nicht gelesen, aus Angst davor, damit bereits eine Reise auszulösen.
Denn, das fragte ich mich in jeder einzelnen Minute, was würde mich auf der letzten Seite erwarten? Würde die dahinter verborgene Welt besser sein als diese? Oder viel, viel schlimmer?
Diese Frage war wichtig, denn dann gäbe es keine Flucht mehr und auch kein Zurück. Wie immer dieser neue Ort sein würde: Er würde für mich letztlich das werden, was ich so lange hinter mir lassen wollte:
Meine Heimat.
Und noch eine Frage beschäftigt mich, jenseits aller Risikoabwägungen. Jenseits aller Ängste und Hoffnungen. Das Fernweh war letzte Nacht wieder erwacht und ich fragte mich: Wie lange kann ich seinem Ruf noch widerstehen?
Fortgeschritten:
Nutzung gemäß CC-BY-SA Quell-Link

